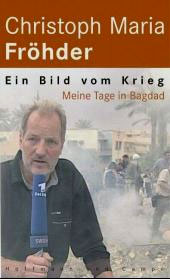Der Krisenberichterstatter ist ein Journalist, der politische und gesellschaftliche Hintergründe von Konflikten intensiv recherchiert und der Öffentlichkeit präsentiert. Damit wird er automatisch zum Sprachrohr der in Konflikten unterdrückten Zivilbevölkerung. Er muss sich also behutsam auf das Leid von Familien einlassen und dies in eine Schilderung der örtlichen Machtverhältnisse einbetten. Wichtigste Grundvoraussetzung ist: Der Krisenreporter muss die Kultur und Tradition des Gastlandes nicht nur kennen, er muss sie respektieren. Im Dialog oder Interview mit jenen Politikern, die für die Krise mitverantwortlich sind, hat der Krisenreporter die Aufgabe möglichst umfassend informiert aufzutreten. Nur so wird verhindert, dass man versucht ihn mit allgemeinen Floskeln abspeisen. Ein Beispiel: Als ich nach langem Zögern 1995 erneut für eine Reportage nach Kambodscha reiste ergab sich per Zufall die Gelegenheit zu einem Interview mit König Sihanouk. Anfangs wollte er uns abwehren. Als ich dann aber detailliert nach seiner Mitverantwortung für die Mordtaten der Roten Khmer fragte, konnte er uns nicht ignorieren, ohne das Gesicht zu verlieren. Es entwickelte sich dann ein Streitgespräch, in dem er sich zu rechtfertigen versuchte. Als ich seine historische Darstellung mehrfach korrigierte, steigerte er sich vor der laufenden Kamera immer mehr in Extase. Wahrscheinlich hat er nie zuvor in der Öffentlichkeit so detailliert über seine Mitverantwortung gesprochen In der Praxis bedeutet dies: Das Niveau der Berichterstattung hängt zu einem wesentlichen Teil davon ab, wie gut der Krisenreporter mit der Geschichte des Konflikts vertraut ist.
Diese hier nur knapp geschilderten Kriterien unterscheiden ihn grundsätzlich vom Kriegsreporter, den die meisten Redaktionen mehr als Allzweckwaffe verstehen.
Der Kriegsreporter bekennt sich –wenn er ehrlich ist- nur allzu häufig zur Lust am Abenteuer. Er soll und will möglichst knallige Bilder und Reportagen liefern. Wenn es für diese Aufgabenstellung nützlich ist, wird auch Zensur oder die moderne Abwandlung, der Einsatz als „embedded-journalist“ akzeptiert. Auf Grund seines Status wird der Kriegsberichterstatter eng mit einer Konfliktpartei kooperieren und den Eindruck erwecken können, er sei in Wirklichkeit näher am Konfliktherd als die anderen Kollegen.
Nach dem 3.Golfkrieg im Jahr 2003 haben mir sogar renommierte Kollegen mit leuchtenden Augen erzählt, sie hätten sich beim Betrachten der Fernsehbildern vom Vormarsch der Amerikaner auf Bagdad, direkt wie bei der Truppe gefühlt. Mich irritiert diese Begeisterung. Nach meinen Erfahrungen verläuft jeder Vormarsch nach dem gleichen Raster, lediglich die Fahrzeuge werden größer, schneller und gefährlicher. Was variiert ist die Stärke des Widerstands, doch den hat es 1991 genauso wenig gegeben wie 2003, weil die irakischen Truppen schlecht ausgerüstet und entmutigt waren. Darüber konnten die „eingebetteten“ Kollegen aber schwerlich berichten, weil fast alle irakischen Soldaten vor den einziehenden Invasionstruppen flohen. Was die „eingebetteten“ Kollegen überhaupt nicht sahen, war das Ausmaß des Luftkriegs gegen die Zivilbevölkerung. Ohne Möglichkeit diesen Kern der amerikanischen Kriegsführung kritisch zu beobachten, wird der Kriegsreporter fast automatisch zum PR-Mitarbeiter einer angreifenden Armee.
Ähnlich war die Situation im Oktober 2001, als die von den Amerikanern geführte Truppe in Afghanistan einmarschierte. Die Invasoren wurden von einer großen Zahl von Kriegsreportern begleitet, die das Gefühl vermittelten, hier werde eine unterdrückte Bevölkerung endlich befreit.
Der typische Krisenreporter sollte möglichst lange vor einer Invasion vor Ort sein. Nur so kann er die Stimmung der Bevölkerung wirklich beschreiben und darstellen wie die „Befreiung“ in der Praxis wirklich stattfindet. Seine Aufgabe ist es die Methode der überlegenen Angreifer ständig zu analysieren ohne zu verschweigen, wie der angegriffene Staat zuvor mit seinen Bürgern umging.
Zusammengefasst: In Afghanistan und später im Irak wurde der Einmarsch durch massive Bombardements vorbereitet, der vornehmlich unschuldige Zivilisten zum Opfer fielen. In beiden Fällen stand die Frage im Raum, wie weit die Angreifer die Substanz der Genfer Konvention verletzten.
Zusätzlich muss der Krisenreporter in dieser Phase ständig das Versagen der Politik beschreiben und die meist – in dieser Anfangsphase – noch sehr selbstherrlichen Akteure kritisch befragen. Für diesen Arbeitsansatz braucht er die bereits geforderten Grundkenntnisse über das Konfliktland, die dort zelebrierte Herrschaftsform genauso wie fundierte Kenntnisse über die unterschiedlichen Ansätze moderner Kriegsführung. Nur so kann er frühzeitig ein-ordnen, was auf die Bevölkerung zukommen wird und wie weit sich der Eingriff mit den politischen und gesellschaftlichen Grundsätzen der Länder in Einklang bringen lässt, die für die Invasion verantwortlich sind. Wenn er dann noch warnend auf die Risiken des Einklangs zwischen eingebetteten Kriegsreportern und den militärischen Strukturen der anrückenden Truppen hinweist, hat er spätestens alle gegen sich: Die Politik, die Militärs und die Kollegen. Um seinen erarbeiteten Standpunkt dennoch glaubhaft vertreten zu können, braucht der Krisenberichterstatter erhebliche Erfahrungen in der Alltagsberichterstattung, denn nur so ist er in der Lage die unterschiedlichen Mechanismen einzuordnen und ihnen mit der gebotenen Autorität zu begegnen. Dazu ein Beispiel:
Während der sowjetischen Besatzung Afghanistans waren ein Kameramann und ich mit einer Truppe der Mujahedin unterwegs, die den Ruf hatte besonders erfolgreich zu sein. Bei dieser Reportage wollten wir feststellen, wie intensiv die Zivilbevölkerung die Widerstandskämpfer wirklich unterstützt und wie viel Gelände von den Mujahedin mittlerweile kontrolliert wird. Zusätzlich hatte die nur allzu interviewfreudigen Führer uns in Peshawar erzählt, alle sowjetischen Militärcamps seien seit Wochen umzingelt. Die Besatzer würden deswegen nur noch mit gepanzerten Helikoptern aus der Luft versorgt.
Der von uns erlebte Alltag sah völlig anders aus. Nächtelang marschierten wir mit den Freiheitskämpfern über steile Berge und Schluchten. Häufig mussten wir vor sowjetischen Flugzeugen und Helikoptern in den Schutz der nächsten Felswand fliehen. Die wenigen Siedlungen der Region wurden erkennbar gemieden, die von uns gewünschten Gespräche mit der Zivilbevölkerung waren nicht möglich.
Nachdem all meine ständig wiederholten Fragen einfach unbeantwortet blieben, stellte ich dem Führer der Mujahedin -Einheit ein Ultimatum. Entweder müsse er uns in ein Dorf bringen und uns dort unkontrolliert mit den Menschen sprechen lassen oder uns wenigstens zeigen, wie nah sie wirklich an die sowjetischen Militärcamps herankommen.
In der folgenden Nacht marschierten wir in gewohnter Manier bergauf, bergab. Zu Beginn des Tages wurden wir aufgefordert unsere Kamera bereit zu halten. Als dann die Morgenröte kam, krochen wir hinter den Kämpfern auf die Spitze des nächsten Berges. Oben angekommen bauten die Mujahedin ihre mitgeschleppten Granatwerfer auf und sagten uns, sie würden jetzt das Dorf im Tal beschießen. Der Anführer erklärte uns, dann hätten wir ja unsere ersehnten Bilder. Auf die Frage, warum das Dorf beschossen werden solle, antwortete er, die Bevölkerung der Region habe sich gegenüber dem Freiheitskampf ablehnend verhalten und solle deswegen eine Lektion erhalten. Diese Äußerung fiel vor laufender Kamera. Als ich irritiert einwand, ein solches Verhalten sei unverantwortlich, damit würden die Mujahedin sich auf die gleiche Stufe wie die brandschatzenden Sowjets stellen und wir seien nicht bereit zu Mittätern zu werden, ernteten wir blankes Unverständnis. Was wir denn wollten, wenn man uns derart aufregende Bilder anbiete ? Der Dialog war kurz, ich beendete ihn mit der nachdrücklichen Feststellung, wir würden die Szene nicht drehen und über den skrupellosen Anschlag auf die Bevölkerung berichten. Die Antwort war ein Schwall von Beschimpfungen, die unser Dolmetscher sich kaum zu übersetzen traute. Auch diese Sequenz haben wir mitgedreht. Anschließend traten wir nur in Begleitung des Dolmetschers den Rückweg an. Die Mujahedin haben das Dorf vermutlich nicht beschossen, jedenfalls hörten wir bei dem müheseligen Rückmarsch keine Detonationen. Wir haben dann nach der Rückkehr in Peshawar zu dem Ablauf der missglückten Reportage noch ergänzende Interviews über die Kriegsführung der Rebellen gedreht und aus dem gesamten Material einen sehr kritischen Beitrag über das Menschenbild der Mujahedin produziert. Ein Beitrag mit diesem Tenor war in der Phase des kalten Kriegs, nicht leicht auf den Sender zu bekommen.
Nach meiner Erfahrung wäre der Ablauf der Reportage völlig anders gewesen, wenn ein typischer Kriegsreporter Leiter des Teams gewesen wäre. Für diese Berufsgruppe sind ethische Interventionen eher die Ausnahme, sie gelten sogar als verpönt.
Der Kriegsreporter fotografiert und filmt was die Kämpfer machen, versteht sich meist als stiller Beobachter, für den es eher verpönt ist, die Abläufe durch kritische Fragen zu beeinflussen. Frei nach dem auch häufig von der Redaktion geforderten Motto: Je mehr Pulverdampf, um so besser die Story.
Der Krisenreporter sollte sich dagegen immer verpflichtet fühlen die Regeln der journalistischen Ethik zu beachten. In Einzelfällen muss er sie auch offensiv vertreten. Er wird zudem den wirtschaftlichen Faktor seiner Tätigkeit kritisch beachten, während für den Kriegsberichterstatter die gute Story und der finanzielle Erfolg automatisch zur Einheit werden.
Generell gilt: Jeder Bericht aus einem Kriegsbericht steigert die Auflage oder Quote. Dabei ist es nach der Erkenntnis von Medienwissenschaftlern egal, welche Haltung die Redaktion und der Mann vor Ort zu dem Konflikt einnehmen. In diesem scheinbaren Schwachpunkt liegt zugleich aber auch die Chance für den Krisenberichterstatter. Er kann die Aufmerksamkeit und Wissbegier der Rezipienten mit Informationen über die Lage der Zivilbevölkerung in der Krisenregion stillen und so zum gegenseitigen Verständnis beitragen, ohne in der Redaktion als jemand betrachtet zu werden, dessen Reportagen langweilig sind.
Der Krisenreporter muss auch immer ein glaubwürdiger Journalist sein. Er kann dies auch dadurch erreichen, wenn er die schwierigen Bedingungen der Berichterstattung nicht auslässt. Wer deutlich zeigt, wo und von wem in der Krise die Grenzen für die Presse gezogen wird, sagt damit manchmal mehr über das Demokratieverständnis der am Konflikt beteiligten Parteien aus, als jeder gedrechselte Kommentar.
Besonders wichtig sind Kommentar- und Bildsprache. Die Darstellung von Fotografen und Kameraleuten darf nicht zu sehr von einer eigenen Handschrift geprägt sein und dadurch die Darstellung der Wirklichkeit beeinflussen. Ästhetische Bildsprachen sind zwar gut für mögliche Preise, doch meist vernebelt zu viel Ästhetik die brutale Wirklichkeit vor Ort. Aber auch emotionale Bilder sind eine Gefahr, denn häufig vermitteln sie nur Schrecken und Mitleid, wo politische Reflexion erforderlich ist. Auch die direkte Parteinahme sollte die Ausnahme bleiben. Der häufige Gebrauch entwertet sie, oft ist eine nüchterne Beschreibung der Gräuel informativer. Damit entgeht man zugleich der Gefahr, Leser und Zuschauer zu bevormunden.
Auch die von einigen Reporten praktizierte Selbstreflexion kann schnell zur Masche verkommen. Krisenberichterstatter können durch sauberes und transparentes Berichten die Sicht auf einen Konflikt maßgeblich beeinflussen. Damit werden sie für die moderne Mediengesellschaft unentbehrlich. Allein sie können frühzeitig Desinformationskampagnen der Konfliktparteien durch sachliche Berichte entlarven. Der Kriegsreporter wird eine solche Kampagne eher übernehmen, ohne die dahinterstehende Manipulation offen zu legen.
Erfahrene Krisenreporter berichten auch nach dem scheinbaren Ende eines Konflikts nachhaltig über die Folgen. Das kann wie in Somalia und Irak die früh erkennbare Auflösung des Staatsapparats sein, aber genauso die langfristigen Folgen von Tschernobyl.
All dies sind Reportagen mit hohem Risiko. Einerseits wegen der äußeren Gefahren und anderseits weil kaum eine Redaktion solche Aufträge heute noch erteilt. Meist will der Krisenreporter aus journalistischer Neugier einfach wissen, wie sich eine Situation in den letzten Jahren weiterentwickelt hat. Zwar wird diese Neugier in fast allen Handbüchern als die beste Triebfeder für guten Journalismus beschrieben, doch als redaktionelles Entscheidungskriterium mittlerweile intensiv verleugnet. Daher liegt der typische Krisenreporter auch häufig im Clinch mit seinem Auftraggeber. Dieser wird immer auf abgesicherter Vorrecherche beharren, als müsse dann der möglichst kurze Besuch vor Ort die Schreibtischergebnisse nur noch bestätigen. Viele Krisenreporter besuchen deswegen ihre Berichtsgebiete auf eigene Faust, finanzieren die Reise also vor. Das war bis zur Jahrhundertwende eine anerkannte Methode. Meist haben die Redaktionen das Ergebnis nur allzu gern übernommen, weil die Reportage des Krisenreporters sich deutlich von der Regelberichterstattung abhob. Dies hat sich im Zeitalter des allgemeinen Sparens völlig verändert. Immer häufiger wird abgewiegelt. Weil in den journalistischen Hierarchien unter dem Druck des „elektronischen-Alltags“ nur allzu häufig der journalistische Ehrgeiz abhanden gekommen ist, werden immer seltener schwierige Hintergrundberichte in Auftrag gegeben.
Reist der Krisenreporter doch auf eigene Faust, trägt er heute das doppelte Risiko. Meist kann er sich die wenigen, teuren Versicherungen nicht leisten. Bietet ihm dennoch eine Assekuranz eine solche Versicherung an, zahlt er deutlich mehr als das große Verlagshaus oder der Sender, die wegen der Vielzahl der Verträge immer günstigere Konditionen erhalten. Der mehrfache Versuch von Journalistenorganisationen eigenen Versicherungsschutz anzubieten, ist bislang noch eine Notlösung. Viele der Verträge sind sehr verklausuliert und dadurch schwer durchschaubar. Meist wird echtes Kriegsrisiko gar nicht mehr abgesichert, oft decken die üblichen Versicherungen nur den Transport zu Luft und Wasser bei unvorhergesehen Kriegsereignissen ab. Lloyds London versicherte in den siebziger Jahren fast alle Berichterstatter der Asienkriege.
Heute fällt die Antwort meist negativ aus oder die Prämien sind unbezahlbar. Eine denkbare Alternative wäre ein Zusammenschluss großer Verlage und Medienanstalten zu einer Eigenversicherung, doch dafür fehlt derzeit der Wille.
Die Kernfrage, wie man Krisen- oder Kriegsreporter wird ist nicht einfach zu beantworten. Zu unterschiedlich sind die meisten Kollegen in diesen Berufszweig gekommen. Eher selten gibt es Kurse von Journalistenorganisationen, regelmäßig dagegen die Kurse der Bundeswehr in Hammelburg. Sie dauern meist eine Woche, in der eine Art Basiseinweisung mit zahlreichen Rollenspielen stattfindet. Wer noch keinen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat, lernt hier diese Grundkenntnisse genauso, wie elementare Waffenkunde und das Verhalten bei Überfällen oder die Reaktion auf explodierende Minen. Ob das Kursziel: „Verbesserter Eigenschutz und Vertrauensbildung zwischen Streitkräften und Journalisten“ wirklich in dieser Zeit erreicht wird, scheint zweifelhaft. Im übrigen sollten Journalisten zu dem möglichen Kriegsteilnehmer –also heute auch der Bundeswehr- kein Vertrauen haben. Nur kritische Distanz ermöglicht eine vernünftige Einordnung der Konfliktteilnehmer. Viele Berichte aus dem Kosovo oder Afghanistan haben den penetranten Geruch von Hofberichterstattung. Natürlich wäre es von der Bundeswehr zu viel verlangt, wenn sie in diesen Schnellkursen auch noch die Kritik am eigenen System fördern würde. Dies ist die grundsätzliche Aufgabe von Journalistenverbänden. Leider versagen sie in diesem Sektor.
Sehr problematisch waren Gespräche mit Absolventen des Kursus in Hammelburg. Fast alle fühlten sich nach der fünftägigen Einweisung ausreichend vorbereitet und schilderten den Kursverlauf in nahezu schwärmerischer Form. In dieser Scheinsicherheit kann aber ein hohes Risiko liegen.
Für den Weg zum guten Krisen- oder aber auch Kriegsberichterstatter gilt gemeinsam: Bevor man in einen solchen Einsatz fährt, sollte man auf einem anderen journalistischen Feld viel Erfahrung gesammelt haben. Gerade in kritischen Situationen kann handwerkliche und berufliche Routine lebensrettend sein.
Ganz wichtig ist auch eine solide technische Ausstattung. Wer um seine Bilder abzusetzen quer durch ein Kriegsgebiet fahren muss, trägt ein zusätzliches Risiko. Mit der modernen Elektronik können fast alle Arbeitsprozesse direkt vor Ort erledigt werden. Ist der Konflikt scheinbar vorbei, wird das Risiko für einige Tage noch höher als vorher. Das war am Ende des Kosovo-Krieges so, als fliehende Serben zwei STERN-Reporter ermordeten, um deren Fahrzeug zu rauben. Aber auch die Amerikaner beschossen trotz aller Warnungen beim Einmarsch nach Bagdad das bekannte Pressehotel Palestine und ermordeten zwei Kollegen, drei weitere wurden schwer verletzt. Wir haben am Ende solcher Kriege immer versucht, uns nicht ungeschützt allein über weite Strecken zu bewegen. Wobei ein solches Verhalten die Risiken allenfalls mindert.
In den letzten drei Jahren ist die Situation von Krisen- und Kriegsreportern deutlich schwieriger geworden, weil auch sie zu beliebten Entführungsopfer wurden. Hier ist der Krisenreporter stärker gefährdet. Anders als der Kriegsberichterstatter muss er immer wieder versuchen, auf eigenen Faust zu recherchieren. Eine Begleitung durch Militärs führt an der Wirklichkeit vorbei, selbst Bodyguards stören jede Hintergrundrecherche. Der freie Umgang mit möglichen Informanten erhöht aber natürlich das Risiko entführt zu werden. Bei ideologischen oder rein kriminellen Tätern hilft nur der schnelle Freikauf — so bitter das auch sein mag. Freiberufler sind da meist in der ungünstigsten Situation, denn nur selten fühlt sich jemand für sie verantwortlich. Aber wie die Beispiele im Irak und Palestina zeigen, ist auch die Befreiung von angestellten Reportern mittlerweile zu einem schwierigen Verhandlungsprozess geworden.
Gültige Regeln für das Verhalten vor Ort gibt es nicht. Manchmal ist der höfliche Umgang mit Tätern erfolgreich, oft kann – je nach der Zahl der Entführer — auch die gespielte Aggression für einen Moment verblüffen. Dieser Moment der Unsicherheit muss dann schleunigst für den Rückzug genutzt werden.
Wir haben einen Entführungsversuch unterlaufen, weil wir an die arabische Gastfreundschaft appellierten. Welche Taktik man einschlägt (wenn man dazu wirklich die Chance hat) hängt von der eigenen Erfahrung und den Umständen ab. Gerade in einer solchen Krisensituation zahlt sich Erfahrung, aber auch profundes Wissen über die Traditionen des Gastlandes aus.
Nachdem fast alle Attentäter sich mittlerweile am Beispiel jenes Terrors orientieren, der täglich im Irak oder Afghanistan stattfindet, kann man daraus zwei, drei grundsätzliche Lehren ableiten: Besonders gefährlich ist das Umfeld von staatlichen und religiösen Einrichtungen. Darunter fallen die Eingänge von Ministerien genauso wie Polizeistationen und Kasernen.
Je nach Situation sitze ich aus Sicherheitsgründen selber am Steuer, denn trotz aller Widrigkeiten wird ein Europäer häufig doch noch respektiert. So kamen wir einmal an einen „Polizeiposten“ der mir unheimlich erschien, weil die Uniformen sehr zusammengestückelt wirkten. Unser Fahrer hätte hier wahrscheinlich gehorsam angehalten. Ich bin mit Vollgas und durchgedrückter Hupe durchgefahren. Alle im Auto haben sich geduckt, doch vermutlich waren die selbsternannten Polizisten völlig verblüfft und haben deswegen nicht auf uns geschossen.
Der wichtigste Unterschied zwischen Krisenreportern und Kriegsreportern ist wahrscheinlich die Angst. Ich habe immer mit Verwunderung gesehen, wie euphorisch sich gerade jüngere Kollegen in kritischen Situationen geben. Selbst wenn – wie in Somalia – Milizen direkt neben uns auf Menschen schossen und auch wir plötzlich ins Kreuzfeuer gerieten, haben sie mit fast lautem Gegröle reagiert. Dies hat die Aufmerksamkeit der Milizen unnötig auf uns gelenkt. Unser Status als neutrale Beobachter war plötzlich gefährdet. Es bedurfte schon intensiver Intervention, bis wir den Schauplatz verlassen durften. Das wechselseitige Rollenspiel wird nach festen Regeln gespielt. Wer durch unbedachte Reaktionen auffällt, riskiert unnötig viel.
Ein Verhältnis zur eigenen Angst zu finden, gehört mit zu den wichtigsten Vorbereitungen. Nur wer sich zu ihr bekennt, kann sie als persönliches Warnzeichen für die eigene Sicherheit nutzen. Ich habe schon Schauplätze verlassen, weil ich plötzlich ein ungutes Gefühl bekam. Der Kameramann fragte mich irritiert nach den Gründen, als ich zu schnellem Aufbruch drängelte. Als wir auf unser entfernt stehendes Auto zuhasteten schlug direkt hinter uns, an der Stelle, an der wir vorher gedreht hatten eine Granate ein. Wahrscheinlich hätten die Splitter uns zumindest stark verletzt.
Generell gilt, wer seine Gefühle nicht beachtet, läuft Gefahr zum Zyniker zu werden.
Aber Krisenberichterstattung ist nur dann vor der Familie zu rechtfertigen, wenn man trotz der ständigen Gegenwart des Todes ein „normaler“ Mensch bleibt, also Mitgefühl empfindet und nicht vorspielt. Bis heute ist mir das gelungen.
© Christoph Maria Fröhder, 27.11.2007