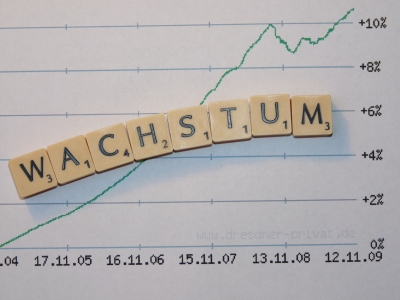Unter „nachhaltiger Entwicklung“ wird zumeist ein erweitertes Vorsorgeprinzip verstanden. Damit soll die ökologische Krise im Einklang mit ökonomischen und sozialen Belangen bewältigt werden. Die entlang des Begriffs der ‚nachhaltigen Entwicklung’ etwa Mitte der Achtziger Jahre einsetzende Diskussion entzweite sich am Wachstumsparadigma. Das Resultat sind zwei konträre Auffassungen darüber, wie ökologische Stabilität mit anderen gesellschaftlichen Zielen in Einklang gebracht werden kann. Grob zusammenfassend lassen sich die im Folgenden als „technischer Weg“ bezeichnete Strömung und die so genannte „Postwachstumsökonomie“ unterscheiden. Der technische Weg baut darauf, weiteres Wertschöpfungswachstum kraft technischer Innovationen zu ermöglichen, während unter „Postwachstumsökonomie“ Konzepte subsumiert werden, die eine quantitative Reduktion des ökonomischen Systems anpeilen.
Zumutungen des Umweltschutzes durch Technik vermeiden
Das technisch orientierte Nachhaltigkeitskonzept ist durch neue Produkte, Produktionsprozesse, technologische und organisatorische Neuerungen gekennzeichnet, mit denen die Industriegesellschaft modernisiert werden soll. Ökologischer Fortschritt, so die Intention, schafft nicht nur neue Märkte, sondern soll helfen, das herrschende Wohlstandsmodell dauerhaft aufrecht zu erhalten und global zu verbreiten. Damit werden zugleich soziale Ziele bedient. Ein Hauptziel ist es, ökonomische und vor allem ökologische Hindernisse oder Negativfolgen des ökonomischen Expansionsprozesses mittels technischer Innovationen aus dem Weg zu räumen. Vermieden werden soll damit vor allem eins: Den Mitgliedern der Wachstumsgesellschaft Verhaltensänderungen oder gar Verzicht zuzumuten. Dementsprechend soll jedes beliebige, nicht zu hinterfragende Konsumniveau auf möglichst Ressourcen sparende und ökologieverträgliche Weise befriedigt werden. Alleiniger Aktionsparameter ist die Optimierung – nicht das Ausmaß oder der Sinn – der Bedarfsbefriedigung. Thematisiert wird nicht das „Wie viel“ oder „Warum“, sondern nur das „Wie“. Diese Vorentscheidung darüber, welche Fragen überhaupt gestellt werden können, hat entscheidende Konsequenzen. Statt über die soziale Ordnung und soziale Unterschiede zu reden, wird das Problem an Wissenschaft und Technik delegiert.
Ansatzpunkte des „technischen Weges“ sind vornehmlich die ökologische Konsistenz (Ökoeffektivität) und Effizienz. Die ökologische Konsistenz zielt darauf, ökonomische Prozesse nach dem Vorbild des ‚biosphärischen Metabolismus’ als System geschlossener Kreisläufe zu organisieren. Demnach entfallen Abfälle, Emissionen und andere Umweltschädigungen, weil Stoffumsätze in den ökologischen Haushalt eingebettet werden. Demgegenüber bemüht sich die ökologische Effizienz um Dematerialisierung. Anstelle einer ökologischen Einbettung (Kreislaufwirtschaft, biologische Abbaubarkeit et cetera) wird hier versucht, die zur Produktion eines bestimmten Outputs erforderlichen Materialien und Energiemengen zu minimieren. Beide Prinzipien, die untrennbar mit technologischem Fortschritt in Form neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen verbunden sind, bilden zusammengenommen die Grundlage für ein „qualitatives“, „nachhaltiges“, also von ökologischen Schäden und Ressourcenverbräuchen entkoppeltes Wachstum.
Unter den Verfechtern dieser Nachhaltigkeitsauslegung scheint geradezu ein Wettstreit um das höchste Niveau an Wachstums- und Überflusskompatibilität entbrannt zu sein. So wollen die selbsternannten Wächter der „Effizienzrevolution“ eine „Wachstumsmaschine“ ankurbeln und bekennen sich explizit zur „Lust auf Wachstum“ oder „Lust auf Luxus“.1 Die Anhänger der Ökoeffektivität fordern nichts weniger als eine „industrielle rEvolution“. Verpackt wird dies – zeitgemäß und um leichten Beifall bemüht – als „kultureller Paradigmenwechsel“, der nun endlich den „pietistischen Leitbildern Sparsamkeit und Reduktion“, „Minimierungsleitbilder[n]“ sowie den „Verzichts- und Schuldbotschaften der Ökos“ eine klare Absage erteilen würde [2].
Von den Grenzen des Wachstums zu einem Wachstum der Grenzen
Technischer Fortschritt ist in dieser Lesart das Scharnier zwischen physischer Begrenzung und ökonomischer Expansion und zielt auf soziale Integration, auf Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit, Gesundheit, Teilhabe, Komfort, Hygiene, konsumtive Selbstverwirklichung, Mobilität und so weiter. Erst die Technologie, mit deren Hilfe die Grenzen des Wachstums in ein Wachstum der Grenzen verwandelt werden sollen, erschließt den materiellen Horizont für das, was im modernen Zeitalter unter sozialer Entwicklung verstanden wird. Wenn Mittel und Möglichkeiten wie etwa Konsum oder Mobilität ständig wachsen, können soziale Konflikte vermieden werden, die der Imperativ einer permanenten Steigerung individueller Selbstverwirklichungsoptionen sonst möglicherweise mit sich brächte.
Schon der Soziologe Simmel sah in der Aneignung des Naturraums den Schlüssel für jedweden gesellschaftlichen Fortschritt. Damit die „Menschheitstragödie der Konkurrenz“ um knappe Mittel beendet werden könne, seien soziale Konflikte in solche zwischen Mensch und Natur umzulenken. Freiheits- und Gerechtigkeitsvorstellungen folgen damit dem Schema eines Positivsummenspiels, bedürfen also einer Expansion der materiellen Grundlage. Nur so gelingt es, wachsende Ansprüche konfliktfrei zu bedienen: Der Status Quo jener, die über ein höheres Ausstattungsniveau verfügen, muss zu diesem Zweck nicht angetastet werden. Nicht Umverteilung, sondern nachholende Entwicklung durch ein Wachstum der Verteilungsmasse soll Gerechtigkeit herstellen. Das Technologische wird folglich zur Bedingung des Sozialen und – neuerdings – des Ökologischen.
Die Alchemie der Innovation
Der technische Weg überbrückt die Kluft zwischen unbegrenzter Anspruchssteigerung und physischer Endlichkeit allerdings nur theoretisch: Klimawandel, Ressourcen- und Finanzkrise lassen die schöne Füllhornlogik an der Realität zerschellen. Die Aufrechterhaltung des Wachstumsparadigmas verlangt mit anderen Worten technische Fortschrittsleistungen, die das momentan Mögliche übersteigen. Diesen Widerspruch soll das Innovationsprinzip aufheben. Es beruht darauf, Problemlösungen oder neue Handlungsmöglichkeiten hervorzubringen, die die vorhandenen Beschränkungen überwinden und den Bruch mit dem Vorhandenen und Bekannten vollführen. Technische Innovation bedeutet den Vorstoß ins Ungewisse, um dort das erlösende Neue freizulegen. Innovationsprozesse entziehen sich einer exakten Prognose und Steuerung. Sie stellen bewusst eingegangene Wagnisse dar, die mit Chancen und Risiken einhergehen: „No risk no innovation!“
Dabei produziert die Innovationsorientierung moderner Industriegesellschaften systematisch Überraschungen. Zumeist sind sie geradezu schicksalhaft negativ. Da sie aber meist zeitverzögert eintreten, lassen sie sich verdrängen. Zugleich bilden sie die Plattform, auf der das Innovationsversprechen greifen kann: Es stellt Lösungen in Aussicht, die zwar gegenwärtig noch nicht bekannt sind, aber zukünftig zu erwarten sind oder an die sich zumindest glauben lässt.
So soll die unhintergehbare Realität, dass eine Ausdehnung des Wohlstandsarsenals nicht ohne Beanspruchung physischen und ökologischen Raums gelingt, der schon vollständig okkupiert ist, durch die technische Erschließung ungeahnter Ausweichmöglichkeiten ausgetrickst werden. Basisinnovationen wie zum Beispiel UMTS, Kernfusion, Geothermie, Photovoltaik, Nanotechnologie, Mikrorobotik, Gentechnik, Ambient Intelligence, RFID et cetera markieren den nächsten Vorstoß aus der Beengtheit, indem tiefer in die längst verdichteten Sphären eingedrungen wird. Da bis zur Besiedlung des Mars kein neuer planetarischer Raum verfügbar ist, könnte einstweilen der bereits erschlossene nochmals okkupiert werden. Seine Substanz, ganz gleich ob anorganisch, organisch oder gar menschlich, ließe sich durchaus – so das neue Innovationscredo – weitere Male verwerten, wenn seine Mikrostruktur beherrschbar wird. Im molekularen Bereich und in den Keimbahnen ist schließlich noch Platz. Später dann hoffentlich auch anderswo: Vielleicht erlaubt die Weiterentwicklung elektromagnetischer Strahlung demnächst Materietranslokation innerhalb des Sonnensystems… Beam me up, Scotty.
Derlei Fortschrittsillusionen imprägnieren den Expansionskurs gegen die Einsicht, dass womöglich die davon eilenden Ziele, die die Aufmerksamkeit im Bann der technischen Mittel halten, bescheidener formuliert werden müssen. Aber gesellschaftliche Ziele an die ökologisch verantwortbaren Möglichkeiten heranzuführen, welche tatsächlich vorhanden sind und nicht nur als bloße Utopie beschworen werden, entspräche keinem technischen, sondern einem wirklichen, einem kulturellen Wandel. Der lässt indes solange auf sich warten, wie das schöne Zitat von Mark Twain gilt: „Kaum verloren wir das Ziel aus den Augen, verdoppelten wir unsere Anstrengungen.“
Statt ziellose Verdoppelung der Anstrengungen…
Die wachstumskritische Auslegung des Nachhaltigkeitsbegriffs ruht auf gänzlich anderen Prämissen: 1. Für eine stetige Expansion der Wertschöpfung fehlt die dauerhafte Ressourcenbasis („Peak Oil“, „Peak Everything“). 2. Eine Entkopplung des Wachstums durch Effizienz- oder Konsistenzinnovation gelingt nicht. 3. Wirtschaftliches Wachstum bewirkt ab einem bestimmten, in den nördlichen Industriestaaten längst erreichten Niveau keine weitere Steigerung des individuellen Wohlbefindens. 4. Die soziale Logik des Wirtschaftswachstums, wonach Zuwächse als probates Mittel zur Beseitigung von Armut und „Gerechtigkeitslücken“ vonnöten seien, ist hochgradig ambivalent. In der Praxis führen eben die Maßnahmen, die Wachstum erzeugen, oft gerade zur Verstärkung von Ungleichheit.
Folglich zielen Ansätze der Postwachstumsökonomie auf eine Eindämmung von Wachstumsursachen. Anvisiert werden suffiziente Lebensstile im Sinne einer „Entrümpelung“ und „Entschleunigung“. Konsumaktivitäten sollen aber nicht nur reduziert werden, sondern punktuell und graduell in Eigenarbeit, moderne Formen von Subsistenz und regionales Wirtschaften umgewandelt werden, um die Abhängigkeit von globalisierten, hochgradig unberechenbaren Wertschöpfungsprozessen zu mildern. Damit ist kein „zurück in die Steinzeit“ gemeint, sondern eine veränderte Balance zwischen konsumtiver Fremdversorgung und deglobalisierter Selbstversorgung. Bescheidenere, aber sozial stabilere und ökologisch verträgliche Versorgungsstrukturen beruhen auf einer einfachen Logik: Es geht darum, den auf Geldwirtschaft, globaler Arbeitsteilung und Wachstum gründenden Industriekomplex, der zwischen Verbrauch und Produktion liegt, auszutrocknen.
Während Innovationen einen sozialen Strukturkonservatismus unterfüttern, stellt die Postwachstumsökonomie dem dominanten technischen einen kulturellen Weg gegenüber: Ohne Wandel von Zielen und Ansprüchen, deren Maßlosigkeit kulturgeprägt ist, lassen sich die Existenzgrundlagen langfristig nicht erhalten. Zudem befreit dieser Weg aus der Geiselhaft von technischem Fortschritt und geldbasierter Fremdversorgung.
… ein Ende der Verteilungsdifferenzen
Die verteilungspolitische Dimension der Postwachstumsökonomie erstreckt sich nicht nur auf eine Stärkung individueller, lokaler und regionaler Daseinsmächtigkeit. Insoweit keine weiteren Zuwächse verteilt werden können, gelten die Regeln eines Nullsummenspiels. Die Umverteilung vorhandener Werte anstelle deren Expansion kehrt das landläufige Gerechtigkeitsparadigma für die Bewohner der prosperierenden Industriestaaten um: Nicht großzügiger geben, sondern bescheidener nehmen, hieße das adäquate Motto für eine Nivellierung globaler Verteilungsdifferenzen. So entstünden auf wachstumsneutrale Weise Spielräume für die Anhebung des materiellen Lebensstandards, wo das erforderlich ist, um ein menschenwürdiges Dasein zu gewährleisten.
Die Rolle der Technik träte hinter der des Sozialen zurück. Sie bestünde darin, die physische Seite der Wachstumsneutralität zu gestalten. So genannte „stoffliche Nullsummenspiele“ 3 umfassen Produktionsprozesse, die an der bereits okkupierten Substanz ansetzen, anstatt neue materielle Artefakte in die Welt zu setzen. Der Fokus läge nicht auf neuer Produktion, sondern dem Erhalt, der Um- und Aufwertung vorhandener Produktbestände und Infrastrukturen, etwa durch Renovation, Konversion, Optimierung, Nutzungsdauerverlängerung oder Nutzungsintensivierung. Das letztgenannte Konzept kann auch in einer veränderten Verteilung der Nutzungsrechte an materiellen Gütern bestehen. Das Prinzip derartiger Maßnahmen des Bestandserhalts liegt darin, den existenten Objekten zusätzliche Nutzungspotenziale abzuringen. Dies gelingt im Extremfall auch komplett ohne arbeitsteilige und geldvermittelte Wertschöpfung, nämlich dann, wenn eigene Kreativität oder Imagination aufgebracht wird, um den längst vorhandenen Dingen neuen Sinn einzuhauchen, sie aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten und sie damit längerfristig als befriedigend zu empfinden.
© Der Artikel wurde auf der Website des Gen-Ethischen-Netzwerkes veröffentlicht. Wir bedanken uns für die freundliche Abdruckgenehmigung.
————————-
- Lehner, F./Schmidt-Bleek, F.: Die Wachstumsmaschine, München 1999, S. 301 u. 320.
- Braungart, M. R./McDonough, W. A.: Die nächste industrielle rEvolution, in: Politische Ökologie 62 (1999), S. 18-22.
- Paech, N.: Nachhaltiges Wirtschaften jenseits von Innovationsorientierung und Wachstum, Marburg 2005, S. 255ff